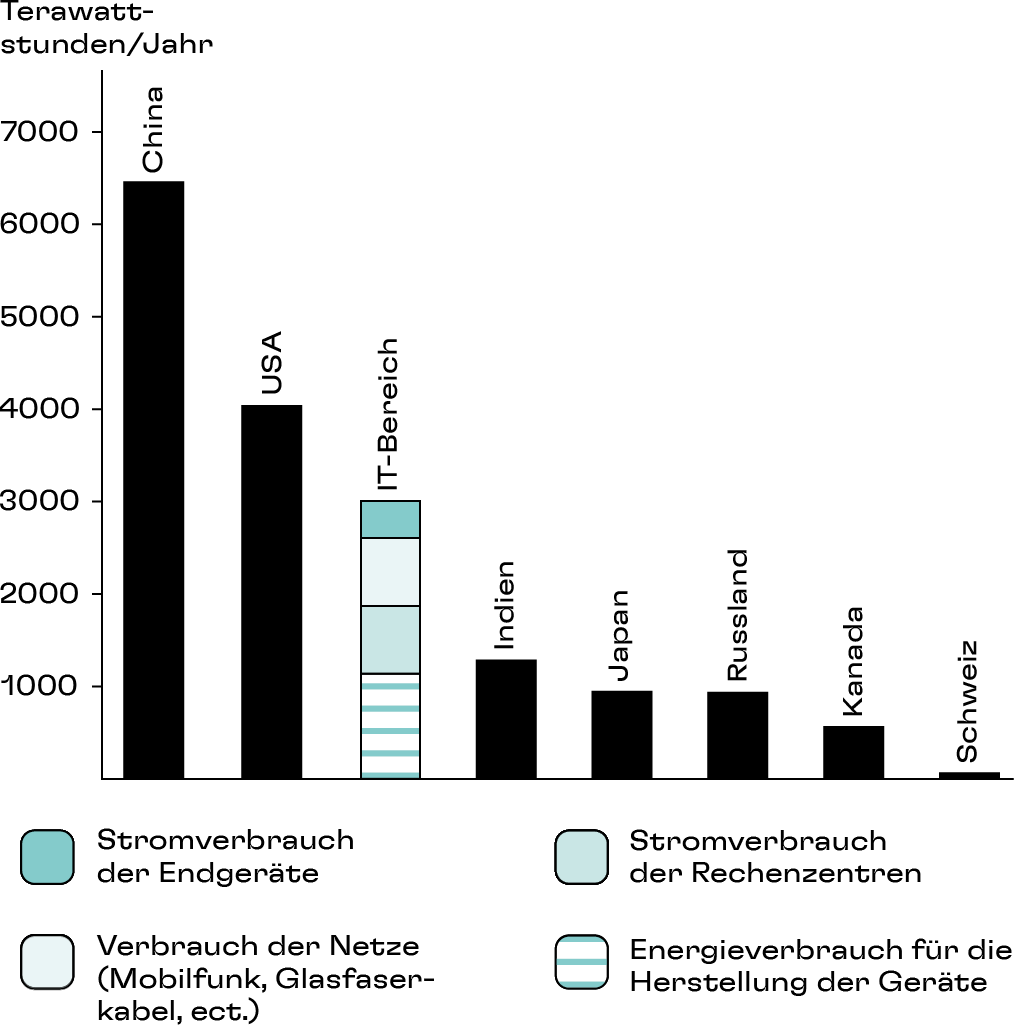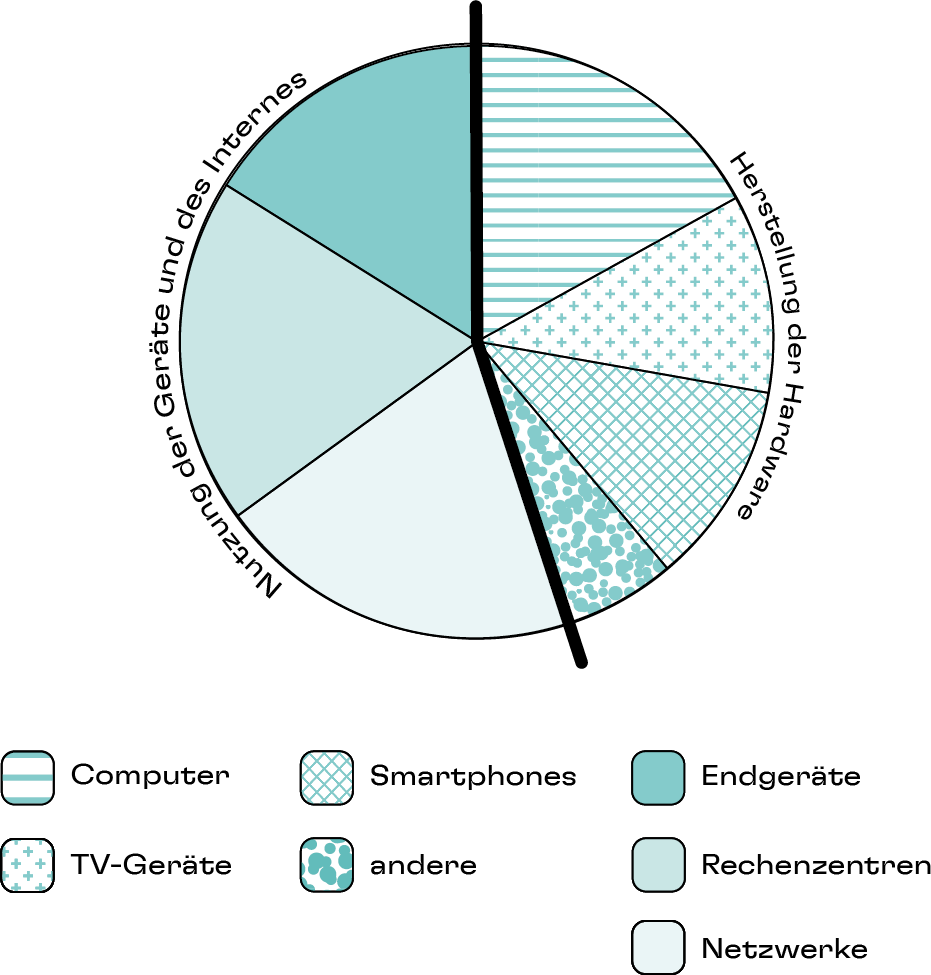Grundlagen
Warum hängen wir so sehr an Apple & Co?
Apple ist beliebt, weil Apple alles dafür tut, seinen Nutzer:innen das Leben in der digitalen Welt möglichst einfach zu gestalten. Vom iMac über das iPhone bis zur Apple Watch sind alle Geräte über die iCloud verbunden und synchronisiert. Das ist praktisch, so lange man nicht vorhat, das Apple-Universum zu verlassen.
Dabei operiert Apple mit proprietärer Software. Die Codes der Programme, die auf den Geräten laufen, sind weder einsehbar noch veränderbar. Alles ist geheim und privates Eigentum von Apple. Das führt auch dazu, dass wir Geräte entsorgen müssen, die eigentlich noch perfekt funktionieren, weil Apple zum Beispiel regelmässig mit neuen Betriebssystemen aufwartet, die die Fähigkeiten eines älteren Gerätes sprengen. Der Speicher wird damit gefüllt, die Apps funktionieren nicht mehr, das Gerät ist noch top, aber die neuen Programme machen es zu Schrott. Apple ist nur ein Beispiel. Die meisten Firmen, die eine Möglichkeit sehen, dieses Geschäftsmodell einzusetzen, tun das heute.
Eine nachhaltig digitalisierte Welt sieht anders aus: Sie basiert auf sogenannter Freier-Open-Source-Software (FOSS). Bei diesen ist der Quellcode – die Rezeptur – offen einsehbar. Unabhängige Spezialist:innen können den Code begutachten und Fehler wie Sicherheitslücken entfernen. Bei proprietärer Software geht das nicht. Dort entscheiden allein die Firmen, denen die Programme gehören, wie und ob die Programme weiterentwickelt werden.
Das Geschäftsmodell mit proprietärer Software führt dazu, dass einige wenige Firmen immer mächtiger und reicher werden. Gleichzeitig werden die Nutzer:innen immer abhängiger. Denn es ist schwierig, sich aus dem Apple-Universum zu verabschieden. Die eigenen Daten – Fotos, Mails, Kalender, Notizen – in andere Programme zu transferieren, wird immer aufwändiger. Eine nachhaltige Software ist dagegen transparent und steht allen möglichst niederschwellig zur Verfügung. Wie bei Wikipedia ist das Wissen breit verteilt und bleibt auch zugänglich. Das wirkt der Entstehung von Abhängigkeiten und Monopolen entgegen, wie es sie bei Facebook oder Amazon gibt. Viele Menschen haben zum Beispiel auf Facebook grosse Teile ihres Lebens dokumentiert, wo es für immer gefangen bleibt, weil sich die Fotos, Posts und Erinnerungen kaum in eine andere Umgebung zügeln lassen. Dabei gibt es ein Recht auf Datenportabilität und Dateninteroperabilität. Demzufolge müssten wir in der Lage sein, alle unsere Daten aus einem System, wie zum Beispiel Facebook, herauszulösen und in ein alternatives soziales Netzwerk neu einzuspeisen, ohne dass dabei wichtige Informationen verloren gehen. Das funktioniert aber nicht. Denn es fehlt an einheitlichen, verbindlichen Standards. Diese definieren, wie Daten gespeichert und ausgetauscht werden können. Bei den Steckern und Ladegeräten kennen wir das Problem, bei den Daten ist es oft noch viel schlimmer.
Wem gehört deine Musiksammlung?
Musik begleitet uns durchs Leben. In unseren Musiksammlungen stecken viele Erinnerungen und viel Geld. Früher stapelten sich zu Hause Platten oder CDs. Heute sind die Lieblingstitel online auf einer Plattform wie Spotify markiert und stets verfügbar – zumindest, solange man den Dienst abonniert hat. Wer nicht mehr zahlen will, verliert jedoch den Zugang und auch die ganze Musiksammlung. Darüber hinaus sind die Verdienste für die meisten Künstler:innen sehr gering – doch um sichtbar zu bleiben, sind sie trotzdem gezwungen, mitzumachen.
Ein anderes Beispiel ist Amazon. Der Megakonzern lieferte ursprünglich nur Bücher aus. Heute erzielt er mit vielen anderen Dienstleistungen hohe Profite. Amazon ist aber immer noch der grösste Händler von eBooks, die gleich mit dem praktischen Kindle – dem von Amazon hergestellten eBook-Reader – gelesen werden können. Doch wer bei Amazon eBooks kauft, ist im Amazon-Reich gefangen. Die Bücher lassen sich nur umständlich mit anderen Programmen lesen. Sie können weder ausgeliehen, noch weiter verschenkt werden. Hat Amazon das Gefühl, jemand habe gegen die Nutzungsbedingungen verstossen, löscht der Konzern auch mal die ganze Bibliothek vom Kindle. Denn Amazon-eBooks sind nur gemietet.
Das ist bei vielen Plattformen so und führt zu Problemen. Ändert eine Plattform das Geschäftsmodell oder geht Konkurs, verlieren die Kund:innen ihre gesammelten Titel. Darüber hinaus bedienen sich die Konzerne auch noch an den Nutzungsdaten, um diese ökonomisch weiterzuverwerten.
Es gibt aber auch Lösungen: Bücher oder Musik bei alternativen Anbietern in einem offenen Format kaufen und abspeichern. So kann man noch in zehn oder zwanzig Jahren darauf zugreifen, ohne Abogebühren zu zahlen. Und verleihen oder verschenken lassen sie sich auch.
Was kostet es uns?
Microsoft, Apple, Adobe und andere Konzerne mit proprietärer Software verwenden unterschiedliche Tricks, um ihre Kundschaft an sich zu ketten: Sie bieten zum Beispiel ihr Angebot «kostenlos» an, wollen dafür aber freien Zugriff auf die persönlichen Daten der Nutzer:innen. Ein anderer Trick: am Anfang ist das Angebot besonders günstig, bis man sich daran gewöhnt hat, danach wird es schlagartig teuer. Besonders erfolgreich sind dabei Dienste, die menschliche Grundbedürfnisse nach sozialem Kontakt und Kommunikation bedienen. Die dabei anfallenden persönlichen Daten (Interessen, Bedürfnisse, Gewohnheiten, soziale Verbindungen) können dann sehr lukrativ zu Werbezwecken kommerziell ausgenützt werden. Der Staat greift aus Gründen der «nationalen Sicherheit» und für Spionage-Zwecke ebenfalls darauf zu.
Sehr beliebt bei Plattformbetreiber:innen ist das Geschäftsmodell Software-as-a-Service (SaaS), wie das weitverbreitete Office 365 von Microsoft. Die Nutzer:innen besitzen die Programme nicht mehr, sondern bezahlen nur noch für die Nutzung der Webanwendung und das Onlineabo. Wer einmal angefixt ist, bleibt dabei, weil ein Wechsel aufwändig und teuer erscheint.
Microsoft ist besonders geschickt darin, sich unentbehrlich zu machen. Als die Coronapandemie ausbrach, bot der Softwarekonzern weltweit Schulen an, ihr Videokonferenzprogramm «Teams» gratis zu nutzen. Nach einem Jahr müssen die Schulen für die «Teams»-Lizenz bezahlen. Auch der Bund arbeitet zu einem grossen Teil mit Software von Microsoft und zahlt dafür jährlich etwa 30 Millionen Franken – bloss für die Lizenzgebühren.
Dabei gibt es Software, die mit offenem Code funktioniert und allen zugänglich ist. Zum Beispiel das Videokonferenztool BigBlueButton oder das Textverarbeitungsprogramm LibreOffice. Diese Alternativen sind bereits sehr gut, funktionieren aber noch nicht so perfekt wie Zoom, Teams oder Microsoft Office.
Das hat seine Gründe: Weil Freie- und Open-Source-Programme allen zur Verfügung stehen, sind sie oft umsonst nutzbar. Die Entwicklung wird durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit am Leben erhalten. Dabei wären die Alternativen schnell mindestens so gut wie die bekannten Programme, wenn die öffentliche Hand nur einen Teil dessen, was sie den digitalen Grosskonzernen zahlt, FOSS-Projekten zukommen liesse.
Dadurch wäre auch garantiert, dass die damit erstellten Inhalte noch in vielen Jahren zugänglich und bearbeitbar sind. Das ist bei proprietärer Software nicht immer der Fall, lassen sich doch alte Dateien mit neueren Programmen oft nicht mehr öffnen und bearbeiten. Das darin gespeicherte Wissen ist so für immer verloren. Würden wir unser Geld in die Entwicklung gemeinschaftlicher digitaler Produkte und nicht in den Profit weniger Konzerne investieren, könnte das Internet zu einer digitalen Allmend werden: Ein Ort, an dem digitales Wissen und Ressourcen idealerweise für alle frei zugänglich sind.
Was tun?
Man muss kein IT-Crack sein, um sich aus der Umklammerung der digitalen Grosskonzerne zu befreien.
Es ist auch möglich, sein MacBook weiterhin zu nutzen, ohne sich gleich komplett dem Apple-Universum
auszuliefern, da es leicht ist, mit Geräten, Programmen und Plattformen zu arbeiten, die auf offener
Software basieren. Ein erster Schritt kann die Arbeit mit offenen Textverarbeitungsprogrammen oder
Browsern sein (→ siehe Anwendungen). Wer tiefer eintauchen möchte, kann einen Programmierkurs
besuchen und sich mit einem Linux-Betriebssystem vertraut machen. Und wer sein Unternehmen oder
eine Schule nachhaltig digital umrüsten will, kann sich im OSS-Directory umsehen. Es gibt auch eine Reihe guter Tutorials zur Nutzung und Programmierung von FOSS-Lösungen.
Wichtig ist, was die öffentliche Hand tut. Die Verwaltung oder Universitäten müssen Freie- und Open-Source-Software-Alternativen fördern. Die Regel muss lauten: öffentliches Geld gibt es nur, wenn danach die Daten und auch der Code öffentlich sind. Und an den Schulen müssen die Kinder lernen, worum es beim Programmieren geht und was ihnen offene Software bringt.
Wozu das Ganze?
Freie und offene Software kann dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen gerechter, stabiler und zugänglicher wird. Denn dass Wissen öffentlich nutzbar ist, ist zentral für alle. Das zeigt das Beispiel des internationalen Saatgutmarkts. Drei Grosskonzerne dominieren weltweit das gesamte Geschäft. Mit Patenten haben sie es geschafft, existenziell wichtiges Saatgut zu ihrem Privateigentum zu machen. Bäuer:innen sind davon abhängig und dürfen diese privatisierten Sorten nicht weiterzüchten oder verändern. Früher war Saatgut ein Gemeingut. Alle konnten es nutzen und weiterzüchten. Verschiedene Regionen hatten eigene, den lokalen Bedingungen angepasste Sorten. Die Organisation «Open-Source-Seeds» will das Saatgut nun wieder zum Gemeingut machen. Dazu versieht sie Saatgut, das noch nicht den Konzernen gehört, mit einer sogenannten Copyleft-Lizenz. Diese sorgt dafür, dass die Samen und deren Weiterentwicklungen frei verfügbar bleiben. Die Grosskonzerne können sie nicht mehr patentieren lassen. Dieses Gegenstück zum herkömmlichen Copyright entspringt der Kernidee von offener Software. Freier und offener Quellcode bedeutet aber nicht, dass alles gratis ist. Genauso wie Hebammen, Pflegekräfte oder Handwerker:innen für ihre Fachkunde bezahlt werden, gibt es auch in diesem Bereich bezahlte Dienstleistungen: Man bezahlt dafür, dass Programmierer:innen zum Beispiel eine Software den individuellen Bedürfnissen eines Betriebes, einer Schule oder Behörde anpassen – und nicht mehr dafür, dass ein Betrieb ein Programm überhaupt nutzen darf.
Software, die sich der digitalen Nachhaltigkeit verpflichtet, muss vier Freiheiten erfüllen:
- Die Freiheit, das Programm auszuführen wie man möchte, für jeden Zweck.
- Die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und eigenen Datenverarbeitungsbedürfnissen anzupassen. Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung.
- Die Freiheit, das Programm weiterzuverbreiten und damit Mitmenschen zu helfen.
- Die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit freizugeben, damit die gesamte Gesellschaft davon profitiert. Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung.
(mehr auf https://www.gnu.org/philosophy)
Anwendungen
Es gibt gute Alternativen zu den Big-Tech-Programmen. Hier einige konkrete Beispiele, die den Weg in die Freie- und Open-Source-Welt öffnen.
Textverarbeitung
LibreOffice und OpenOffice sind zwei komplette Büroprogramme, die inzwischen schon sehr gut ausgestattet sind und reibungslos funktionieren. Die Programme werden ständig weiterentwickelt. Sie stehen im Netz gratis zur Verfügung. Damit das so bleibt, und die Programme verbessert und gepflegt werden können, bietet sich eine Spende an die Entwickler:innen an.
Suchmaschinen
Der US-amerikanische Konzern Google hat in Europa einen Marktanteil von über neunzig Prozent. Googles geheime Algorithmen bestimmen, was wir im Netz zu Gesicht bekommen und was nicht. Auch erstellt Google Profile der Nutzer:innen, die auch Geheimdiensten zugänglich sind. Es gibt eine Reihe von alternativen Suchmaschinen, welche Suchanfragen weder personalisieren, noch unsere Daten weiterreichen – zum Beispiel Startpage oder DuckDuckGo (mehr dazu in «Eine Kurze Anleitung zur Digitalen Selbstverteidigung»).
Bücher
Bücher digital zu lesen, kann durchaus sinnvoll sein - aber man braucht sie nicht bei Amazon zu beziehen. Diverse alternative Onlineshops bieten eBooks in offenen Formaten an. Lesen kann man diese zum Beispiel auch mit dem Tolino-Reader, den Buchhändler:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit einigen Jahren gemeinsam vertreiben. Der Tolino kann offene Standardformate wie PDF, ePUB oder TXT lesen. Oder man geht zur lokalen Buchhandlung – solange es sie noch gibt.
Musik
Wer Musik unterwegs hören will, ist nicht auf Spotify oder Apple Music angewiesen. Bandcamp ist eine alternative Musikplattform, die sich der miesen Bezahlung der Künstler:innen auf den Standardplattformen widersetzt. Ungefähr vier Fünftel der Einnahmen werden an die Künstler:innen weitergeleitet. Zudem wird die Musik nicht bloss vermietet. Wer ein Album kauft, kann dieses beliebig oft streamen oder auch für die eigene Sammlung im MP3- oder FLAC-Format herunterladen. FLAC ist ein Speicherformat, das Audiodateien – im Gegensatz zu MP3 – verlustfrei komprimiert.
Karten
Google Maps erfreut sich grösster Beliebtheit. Dabei ist das FOSS-Projekt OpenStreetMap eine valable Alternative. Dort können alle mitarbeiten und frei nutzbare Geodaten sammeln und aufbereiten. Apple Maps arbeitet übrigens auch mit OpenStreetMap und stellt selber Daten für die Verbesserung der Karten zur Verfügung. In der Schweiz bietet sich darüber hinaus SwissTopo an. Die offiziellen Landeskarten sind extrem genau und erfassen jeden Winkel der Schweiz. Das Bundesamt für Landestopografie hat alle Karten digitalisiert und bietet diese zur freien Nutzung an. Ein vorbildliches Beispiel dafür, wie mit öffentlichen Mitteln öffentliche Daten gefördert werden, und alle damit arbeiten können.
Wissen
Früher gab es mehrbändige, teure Enzyklopädien, wie den «Brockhaus». Da bestimmte eine Redaktion – meist bestehend aus bürgerlich gebildeten, weissen Männern – was überhaupt ins Lexikon aufgenommen wurde. Die freie Enzyklopädie Wikipedia hat dieses hierarchische System aufgelöst. Alle können Wikipedia nutzen, alle können mitmachen. Dadurch ist weltweit viel Wissen frei zugänglich geworden. Zudem ist Wikipedia die umfassendste Enzyklopädie, die es jemals gab. Allerdings sind es auch bei Wikipedia (noch) weitgehend weisse, technikaffine Akademiker, die die Inhalte bestimmen. MediaWiki heisst die Software hinter Wikipedia. Damit kann jede Person eine eigene Online-Wissenssammlung anlegen und gemeinsam mit anderen bearbeiten. Es gibt weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Etherpad, Cryptopad, nuudle oder NextCloud, die das gemeinsame Arbeiten online erleichtern.
Webbrowser
Der offene Webbrowser schlechthin ist Firefox von der gemeinnützigen Mozilla-Foundation. Er ist schnell und vielseitig und hat sich dem «sicheren Surfen» verschrieben. Der Quellcode ist offen und wird von einer aktiven Community ständig weiterentwickelt. Zudem können zahllose Erweiterungen installiert werden, um den Datenschutz und die Privatsphäre zu erhöhen.
Betriebssystem
Linux ist eine Familie von freien Betriebssystemen, deren Code offen verfügbar ist. Der Kern, im Englischen «Kernel», dient als Basis für viele andere Anwendungen. Ubuntu ist beispielsweise ein Linux-basiertes Betriebssystem, welches sich sehr intuitiv nutzen lässt und ähnlich wie bekanntere Betriebssystem daherkommt. Viele Rechenzentren, Webseiten, auf Android laufende Smartphones und sogar Autos und Flugzeuge werden auf Basis des Linux-Kernels betrieben. Damit zeigt Linux, was dank Freier- und Open-Source-Software möglich ist und wie dies die Digitalisierung voranbringt.